*Erstveröffentlichung in: Okko Behrends/Malte Dießelhorst/Ralf Dreier (Hrsg.), Rechtsdogmatik und praktische Vernunft, Symposion zum 80. Geburtstag von Franz Wieacker, 1990, S. 35 bis 56
Franz Wieacker hat in zahlreichen Beiträgen zu Fragen der Rechtsgewinnung Stellung genommen [1]. Untersuchungen zur Möglichkeit der Gesetzesbindung finden sich zunächst nicht darunter [2]. Die Möglichkeit wird für den Bereich der einfachen Subsumtion im deduktiven Verfahren als quasi selbstverständlich unterstellt [3]. Wieackers Interesse galt anfänglich eher den Grenzen der Gesetzesbindung [4] und stärker noch den Möglichkeiten der Rechtsgewinnung jenseits der Gesetzesbindung [5]. In späteren Beiträgen gewann alsdann die Verteidigung der konventionellen Methoden der Rechtsanwendung gegenüber fundamental-hermeneutischen Widerlegungen, szientifischen Revisionsansprüchen und topischer Bindungslosigkeit immer stärkeres Gewicht [6]. Ich möchte in meinem Beitrag die Möglichkeiten der gebundenen Entscheidung darüber, was in einem gedachten oder tatsächlich stattgehabten Fall hic et nunc rechtens ist, ausloten und die Grenze markieren, jenseits derer die ungebundene Eigenwertung des Entscheiders unausweichlich wird. In diesem Anliegen treffe ich mich mit dem späten Wieacker und der Leitidee, unter der Franz Bydlinski sein Werk “Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff” geschrieben hat, ein Werk, das ich für das bedeutendste Zeugnis und die differenzierteste Ausarbeitung der juristischen Methodenlehre im klassischen Rahmen halte [7]. Auffällig sind die vielen Übereinstimmungen und Paralellen in den gedanklichen Entwicklungen und den Ergebnissen mit dem, was in einem anderen, dem analytischen Rahmen etwa zur selben Zeit entwickelt und vorgestellt worden ist [8]. Schon daran wird deutlich, daß es falsch wäre, den von mir und anderen [9] bevorzugten analytischen Rahmen dem klassischen Rahmen entgegenzusetzen. Der analytische Rahmen dient einzig und allein dazu, in Teilbereichen Probleme schärfer zu fassen und Einsichten zu erschließen, die im klassischen Rahmen unterzugehen drohen. Das gemeinsame Ziel bleibt unverändert: eine Methoden- und Begründungslehre, die den praktischen Aufgaben der Feststellung, Festsetzung und Begründung dessen, was hic et nunc rechtens ist, genügt.
Die Ausdifferenzierung des Justizsyllogismus zum Hauptschema der juristischen Einzelfallentscheidung kann das Anliegen der analytischen Begründungslehre mit Blick auf die hier interessierende Möglichkeit der Gesetzesbindung verdeutlichen. Für Wieacker wie auch noch für Bydlinski ist es offenbar eine ausgemachte Sache, daß im sprachlich klaren Kernbereich einer Gesetzesnorm Rechtsanwendung durch bloße Subsumtion in einem ausschließlich deduktiven Verfahren stattfinden kann [10], in diesem Bereich Gesetzesbindung mithin möglich ist. Dem scheint die Annahme zugrundezuliegen, in diesem Bereich lege das Gesetz den Obersatz des Schlußverfahrens fest. Das ist in einem trivialen Sinne richtig. Das in ein deduktives Hauptschema eingestellte Gesetz legt eine Prämisse der Entscheidung fest. In diesem trivialen Sinne ist die Äußerung aber nicht gemeint. Gemeint ist, daß auch die Entscheidung selbst festgelegt werde. Das wiederum ist nur in einem ganz engen Teilbereich der Fall, der von den Kollegen sicherlich auch nicht gemeint ist. Ich spreche den Bereich an, in dem die anzuwendende Gesetzesnorm genau die Begriffe verwendet, mit denen der zu entscheidende Fall beschrieben wird. In allen anderen Fällen wird das deduktive Begründungsverfahren, der Subsumtionsschluß, erst möglich, wenn die zwischen der Normformulierung und der Sachverhaltsbeschreibung bestehende Kluft überwunden wird. Für die Begründung dieser zusätzlichen Prämisse im Rahmen des deduktiven Hauptschemas gibt das Gesetz aber auch dann nichts her, wenn der Fall im sprachlich klaren Kernbereich der gesetzlichen Ausdrücke liegen sollte. Das Gesetz legt im “Syllogismus” der Rechtsfolgebestimmung nur sich selbst und im Zusammenspiel mit der Sachverhaltsbeschreibung die Struktur des Satzes fest, der erforderlich und geeignet ist, eine Entscheidung deduktiv zu begründen, in der das Gesetz eine unverzichtbare Rolle spielt. Nicht aber entscheidet das anzuwendende Gesetz über die weitere Frage, ob der zusätzliche Satz seinerseits begründet ist. Auch über seinen sprachlich klaren Kernbereich entscheidet nicht das Gesetz, sondern die an das Gesetz herangetragene Sprache. Verdeckt wird diese Einsicht durch die unglückliche Rekonstruktion des Rechtsanwendungsschlusses mit den Mitteln der klassischen Syllogistik.
Die klassische Syllogistik kennt in der Tat nur drei Sätze: zwei Prämissen und den Schlußsatz, und legt dadurch, auf Rechtsanwendungsmöglichkeiten bezogen, die Rede vom Gesetz als Obersatz, dem Fall als Untersatz und der konkreten Entscheidung als Schlußsatz nahe. In dieser Rede werden durch sprachliche Offenheiten hervorgerufene Rechtsanwendungsprobleme leicht zu Problemen der Logik. Da die Logik sie nicht löst, glauben manche, die Logik ganz verabschieden oder ihr doch eine völlig untergeordnete Rolle im Rechtsanwendungsprozeß zuweisen zu können. Die Logik kann (und will) diese Probleme aber gar nicht lösen, weil es nicht um das Schließen selbst, sondern um die Begründung einer für den korrekten Schluß erforderlichen Prämisse geht. Diese Begründung mag leichter sein, wenn man dartun kann, daß die Zusatzprämisse dem unangefochtenen Gebrauch des gesetzlichen Ausdrucks entspricht. An der Tatsache des Begründungserfordernisses außerhalb der Logik und außerhalb des Gesetzes ändert das nichts. Ist damit die Gesetzesbindung schon erledigt? Selbstverständlich nicht! Wir müssen uns nur darüber verständigen, was Gesetzesbindung sein kann und sein soll, wenn das anzuwendende Gesetz das Begründungskriterium für die Zusatzprämisse nicht enthält.
Das Gesagte wird überdeutlich, wenn man nicht nur über das deduktive Hauptschema spricht, sondern sich seine Struktur im wörtlichen Sinne vor Augen führt. Dazu verwende ich auch eine Symbolsprache: die Sprache der Prädikatenlogik erster Stufe unter Einschluß deontischer Operatoren [11]. Das erlaubt eine abgekürzte und präzise Darstellung der angesprochenen Probleme [12].
Zu begründen ist eine Einzelfallentscheidung. Das Ergebnis der Einzelfallentscheidung kann in einem singulären Satz mit einem deontischen Operator formuliert werden. Als prädikatenlogischen Ausdruck notieren wir dafür:
![]()
Im konkreten Fall (a) ist die Rechtsfolge (R) geboten (O).
Es muß eine deduktiv gültige Argumentation zu der Entscheidung führen. Das bedeutet: entweder ruht die Einzelfallentscheidung in sich selbst oder aber in den Gründen (Prämissen), die zu ihrer Begründung angeführt werden. Darin muß sich ein Satz mit einem deontischen Operator finden. Sonst könnte kein singulärer Satz mit einem deontischen Operator abgeleitet und das Postulat der deduktiv gültigen Argumentation nicht erfüllt werden [13].
Wenn wir davon ausgehen, daß juristische Einzelfallentscheidungen nicht in sich selbst ruhen, müssen Gründe angeführt werden, warum die Entscheidung so und nicht anders ausgefallen ist. Wir beginnen mit der Einführung des Sachverhalts. Das ist die Beschreibung eines singulären Geschehens, für die wir als prädikatenlogischen Ausdruck notieren:
2. Sa
Im konkreten Fall (a) haben wir es mit einem Sachverhalt mit den Merkmalen (S) zu tun.
Auch das logisch ungeübte Auge sieht sogleich, daß es von (2) zu (1) keinen deduktiven Übergang gibt. Dazu benötigen wir mindestens noch eine weitere Prämisse. Versuchen wir es zunächst einmal mit der Einführung der Minimalbedingung zur Erfüllung des Deduktivitätspostulats! Das ist ein bedingter singulärer Normsatz, für den wir als prädikatenlogischen Ausdruck notieren:
![]()
Wenn der konkrete Fall (a) die Sachverhaltsmerkmale (S) aufweist, dann soll die Rechtsfolge (R) eingreifen.
Mit einem solchen bedingten Normsatz ist das Deduktivitätspostulat erfüllt, weil nun aus (3) und (2) die Einzelfallentscheidung (1) logisch folgt. Logische Bedenken könnten wir gegen eine solche Begründung nicht erheben, wohl aber rechtliche. Das Gleichbehandlungsgebot verlangt die Heranziehung genereller und allgemeiner Normen. Kadijustiz ist nicht erlaubt.
Wir müssen deshalb eine universelle bedingte Norm einführen, für die wir als prädikatenlogischen Ausdruck notieren:
![]()
In allen und nur den Fällen (x), in denen die Tatbestandsvoraussetzungen (T) erfüllt sind, soll die Rechtsfolge (R) ausgesprochen werden.
Mit dieser Formulierung treffen wir ganz gut die dem Juristen bekannte Redeweise von der Aufspaltung der Normen in einen Tatbestand (= Voraussetzungsteil) und eine Rechtsfolge. Wir kommen aber in Schwierigkeiten mit der Erfüllung des Deduktivitätspostulats. Es gibt keinen deduktiv gültigen Übergang von (4) und (2) zu (1). Den gäbe es nur, wenn wir beim Sachverhalt Ta statt Sa notiert hätten. Mit Sa aber müssen wir eine logische Kluft zwischen der Sachverhaltsprämisse und der Normprämisse feststellen. Diese kann nur durch die Aufnahme weiterer Prämissen überbrückt werden, welche die Sachverhaltsbeschreibung und den Voraussetzungsteil des Normsatzes miteinander verbinden. Hier handelt es sich regelmäßig um semantische Interpretationen (Auslegungshypothesen) der im Voraussetzungsteil des Normsatzes verwendeten Begriffe mit Richtung auf die zur Beschreibung des individuellen Sachverhalts verwendeten Begriffe. Wegen des Gleichbehandlungsgebots müssen auch diese semantischen Interpretationen allgemein sein. Als Beispiel können wir folgenden prädikatenlogischen Ausdruck für eine semantische Interpretation wählen:
![]()
Fälle (x) mit den Merkmalen (S) gehören zu (T).
(5), (4) und (2) erlauben die Folgerung auf (1). Auch (3) ist in (5) und (4) enthalten. Daß (4), die Gesetzesprämisse, nichts für die Richtigkeit von (5), die Auslegungshypothese, hergibt, liegt nun für jedermann sichtbar offen zutage.
Gegenüber dieser Klarstellung möchte der eine oder andere wohl replizieren: “Nichts anderes haben wir im Sinn, wenn wir von der Möglichkeit der Rechtsanwendung durch Subsumtion im sprachlich eindeutigen Kernbereich eines Gesetzes reden. Das Gesetz bindet, weil die Sprache bindet, in der der Gesetzgeber zu uns spricht. Wozu also die Belehrungen durch die analytische Begründungslehre? Wir sollten besser zur Tagesordnung und damit zu den Problemen übergehen, die uns bei der Rechtsfindung wirklich auf den Nägeln brennen. Diese Probleme liegen jenseits der Rechtsanwendung im sprachlich eindeutigen Kernbereich einer Norm.” Zugegeben - dort liegen überaus wichtige Aufgaben für die juristische Methoden- und Begründungslehre, und die analytische Begründungslehre verdiente ihren Namen nicht, wenn sie das Feld jenseits des sprachlich eindeutigen Kernbereichs einer Norm unbestellt lassen würde. Es mag auch sein, daß kluge Theoretiker der Belehrung nicht bedürfen. Doch sind auch alle Theoretiker so klug? Manchmal mag es nützlich sein, auch Selbstverständliches auszusprechen. Das Richtige wird ja nicht dadurch falsch, daß man es hin und wieder einmal sagt.
Überdies macht uns die Analyse auf eine vielleicht versteckte Vorentscheidung [14] für ein Richtigkeits- und Bindungskriterium aufmerksam, das in Konkurrenz zu anderen gedacht werden kann und alsdann gegenüber der Konkurrenz als vorzugswürdig ausgezeichnet werden muß. Wer deduktive Entscheidungsbegründung durch Subsumtion im sprachlich eindeutigen Bereich des Gesetzes als möglich und geboten betrachtet, hat damit für das Richtigkeitskriterium des vom Gesetzgeber GESAGTEN votiert. In Konkurrenz [15] hierzu stehen das vom Gesetzgeber GEWOLLTE und ganz allgemein das VERNÜNFTIGE, das auf den Einklang einer Regel mit der Rechtsidee [16] verweist.
Für die Erörterung der Möglichkeiten gebundenen Entscheidens interessieren uns im folgenden nur die semantischen Interpretationen, die den Tatbestand einer Norm in Richtung auf den Sachverhalt präzisieren, die Auslegungssätze also, die im deduktiven Hauptschema die Kluft zwischen den Normsätzen und den Sachverhaltsbeschreibungen überbrücken. Die Gesetzesnormen, die Sachverhaltsbeschreibungen und die bei Ermessensnormen erforderlichen Tatbestandsergänzungen [17] bleiben außer Betracht. Die Sachverhaltsbeschreibungen liegen grundsätzlich jenseits der Probleme, die mit der Realisierung des Gesetzesbindungspostulats verbunden sind. Sie stehen schlicht unter dem Postulat der Wahrheit, das in den verschiedenen Verfahrensordnungen festgeschrieben ist [18]. Die in das deduktive Hauptschema einzustellenden Gesetzesnormen selbst werfen zwar mitunter schwierige Geltungsfragen auf, die die Bindungsfragen auf die höhere Ebene der Verfassungsbindung heben [19]. Die Gesetzesformulierungen sind aber im übrigen nur Ausgangspunkt und nicht Prüfstein für die Erörterung von Möglichkeit und Grenzen des gebundenen Entscheidens. Prüfstein können nur die nicht in den Gesetzesformulierungen selbst enthaltenen Tatbestandspräzisierungen und Tatbestandsergänzungen sein. Die Bindungskriterien für Tatbestandsergänzungen [20] bilden dabei eine echte Teilklasse der Bindungskriterien für Tatbestandspräzisierungen, so daß sich die Bildung einer besonderen Abteilung erübrigt und wir uns mit den Tatbestandspräzisierungen begnügen können.
Realisierung der Gesetzesbindung als Programm setzt voraus, daß man sich über das verständigt, woran denn der Rechtsanwender gebunden sein soll. Gesetzesbindung als Ziel ist zu allgemein, um problemlos über die Mittel reflektieren zu können, die zur Zielerreichung taugen. Erst eine detailliertere Zielexplikation mit der Erörterung der unterschiedlichen für die Erreichung der möglichen Ziele geeigneten Mittel wird uns in die Lage versetzen, der Diskussion eine Struktur zu geben, in der sich Vernünftiges zu Möglichkeit und Grenzen der Gesetzesbindung ausmachen läßt. In der “Juristischen Begründungslehre” haben wir drei mögliche Ziele benannt, die als Bindungspole und Begründungskritierien für die Auszeichnung von Auslegungssätzen, von semantischen Interpretationen gesetzlicher Begriffe, in Betracht kommen: das vom Gesetzgeber GESAGTE, das vom Gesetzgeber GEWOLLTE und das VERNÜNFTIGE [21].
Es liegt auf der Hand, daß je nach Ziel ganz unterschiedliche Verfahren zur Zielrealisierung eingesetzt werden müßten [22] und dann auch unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten wären. Nach welchen Kriterien aber kann die Konkurrenz-, Rang- oder Subsidiaritätsfrage entschieden werden?
Keine Lösung bietet der Hinweis auf die Verfassung. Zwar spricht das Bonner Grundgesetz in zwei Bestimmungen die Gesetzesbindung an. In der einen ist von vornherein von der Bindung an Gesetz und Recht die Rede (Art. 20 Abs. 3), so daß sich ihr für ein Rangverhältnis wenig abgewinnen läßt. Die andere unterwirft den Richter zwar nur dem Gesetz (Art. 97 Abs. 1). Es ist jedoch durchaus offen, ob nicht aus der in dieser Vorschrift angesprochenen Sicherung der richterlichen Unabhängigkeit die alleinige Stoßrichtung gegen Einflußnahmen der Exekutive auf die Rechtsprechung zu folgern ist. Die Verfassung müßte also in beiden Fällen, um Auslegungsziele für die Auslegung des einfachen Rechts festzulegen, selbst erst ausgelegt werden. Nach welchen Kriterien diese Auslegung zu erfolgen hätte, kann der Verfassung nicht entnommen werden. Es ist dies der Grund, warum in der Begründungslehre die Rangfolgefrage nicht als verfassungsrechtliche, sondern als staatstheoretische Frage charakterisiert worden ist. M.a.W.: sie muß auch dann beantwortet werden können, wenn es gar keine Verfassungsnorm gibt, die die Bindungs- und Rangfolgefrage anspricht.
Für unser Gemeinwesen dürfen wir in Anspruch nehmen, daß der Staat insgesamt der Rechtsidee verpflichtet ist. Das spräche zunächst dafür, dem VERNÜNFTIGEN, das ja der Verwirklichung der Rechtsidee dient, auch bei der Bindungsfrage die höchste Rangstufe einzuräumen. Was indessen das VERNÜNFTIGE ist, kann von jedem einzelnen höchst unterschiedlich beantwortet werden. Aus diesem Grunde richtet das Gemeinwesen Verfahren ein, die es einer demokratisch bestimmten Instanz ermöglichen, das Alternativenspektrum des VERNÜNFTIGEN einzugrenzen und damit das VERNÜNFTIGE vorläufig festzulegen. Die Festlegungen dienen der Rechts- und Orientierungssicherheit als Teil der Rechtsidee und damit des VERNÜNFTIGEN. Gesetzesbindung steht im Dienst der Rechts- und Orientierungssicherheit und ist Bindung an eben diese Festlegungen. Deren Verbindlichkeit hört allein dann auf, wenn eine Festlegung im krassen Widerspruch vornehmlich zur Gerechtigkeitskomponente der Rechtsidee stehen sollte. Dem VERNÜNFTIGEN kommt deshalb eine dreifache Rolle zu: es trägt die Bindung an Festlegungen des Gesetzgebers, begrenzt bei krassen Grenzüberschreitungen der Gesetzgebungsorgane die Verbindlichkeit hier getroffener Festlegungen und hat im übrigen nur noch die Entscheidung in den Freiräumen des GESAGTEN und GEWOLLTEN, gewissermaßen jenseits der Gesetzesbindung, zu leiten. Dem VERNÜNFTIGEN gebührt diesseits des krassen Widerspruchs zur Rechtsidee nicht die Rangklasse 1, sondern die Rangklasse 3 unter den Bindungspolen.
Diese Rangfestlegung deckt sich mit Vorstellungen Bydlinskis [23]. Gegenüber der Rangfestlegung in der Begründungslehre scheint sich demgegenüber eine Abweichung abzuzeichnen, weil dort ein Vorrang des GESAGTEN und/oder GEWOLLTEN vor dem VERNÜNFTIGEN vorgeschlagen wird, ohne der Bindungsbegrenzung bei krassen Verstößen gegen die Gerechtigkeitskomponente der Rechtsidee Raum zu geben [24]. Im Ergebnis bewirkt jedoch die in der Begründungslehre ausgeführte Bindung des Rechtsanwenders an die Verfassung [25], daß krassen Verstößen gegen die Rechtsidee die Verbindlichkeit genommen wird. In der Rechts- und Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland ist kein Fall vorstellbar, bei dem ein krasser Verstoß gegen die Rechtsidee im Sinne Bydlinskis nicht auch zur Unverbindlichkeit der Regelung wegen Verfassungswidrigkeit führen würde. Will man, wie Bydlinski, eine Methodenlehre unabhängig vom positivierten Verfassungsrecht entwickeln, dann ist es nur konsequent - und auch für die Begründungslehre verbindlich - den krassen Verstoß gegen die Rechtsidee als Bindungsbegrenzung für das vom Gesetzgeber GESAGTE und/oder GEWOLLTE einzuführen.
Offen ist, welches Rangverhältnis zwischen den verbleibenden (im Sinne der Gesetzesbindung echten) Bindungspolen gilt. Hier eine Rangordnung festzulegen, ist spätestens dann gefordert, wenn es dem Gesetzgeber nicht gelungen sein sollte, das zu sagen, was er hatte sagen wollen (sprachliche Fehlleistung), oder wenn das, was der Gesetzgeber sagte und sagen wollte, nicht mit dem zusammenpaßt, was er erreichen wollte (teleologische Fehlleistung). In dieser Rangfrage spiegeln sich Teile der uralten Kontroverse zwischen objektiver und subjektiver Auslegungstheorie [26]. Im Kampf um das Alleinvertretungsrecht mag keine der “Theorien” den Sieg davontragen. Die objektive Theorie mit der Verbindlichkeit des nach heutigem Sprachverständnis GESAGTEN und nach heutigen Wertvorstellungen (von wem?) GEWOLLTEN führt geradewegs in die unbegrenzte Auslegung [27]. Der subjektiven Theorie mag die Gefahr der Versteinerung überholter Vorstellungen innewohnen. Sie muß überdies einem möglichen Vertrauen der Rechtsunterworfenen in das GESAGTE weichen. Für eine differenzierte Behandlung der Rangfrage sind die im Für und Wider um den Alleinvertretungsanspruch ausgetauschten Argumente auch jetzt noch von Belang. In der Juristischen Begründungslehre findet sich ein Votum für den Vorrang des GESAGTEN vor dem GEWOLLTEN. Die Haltbarkeit dieses Votums möchte ich hier überprüfen [28].
Da das GESAGTE und das GEWOLLTE in gleichem Maße geeignet sind, Gesetzesbindung zu realisieren [29], ist es staatstheoretisch keineswegs ausgemacht, daß das GESAGTE Vorrang vor dem GEWOLLTEN genieße. Es fällt auf, daß bei den Begründungen für Rechtsfortbildungen die umgekehrte Vorrangregel propagiert wird [30]. Sollte der Vorrang nur für Auslegungen gelten? Dann müßte man zunächst die beileibe nicht geklärte Grenzlinie zwischen Auslegung und Rechtsfortbildung [31] ziehen, um hernach für beide Bereiche unterschiedliche Rangordnungen zur Entscheidungsbindung zu realisieren. Da aber auch Rechtsfortbildungen zuvörderst Zulässigkeitsfragen und damit staatstheoretische Probleme aufwerfen, könnte es lohnen, eine einheitliche Sicht der Rangordnung zu entwickeln. Sie mag dann zu einem Vorrang des GEWOLLTEN vor dem GESAGTEN führen [32]. Das müßte sich jedoch erst an den Gründen erweisen, die für und gegen die eine und die andere Position streiten.
Das Argument in der Juristischen Begründungslehre für den Vorrang des GESAGTEN vor dem GEWOLLTEN lautet, die Bundesrepublik Deutschland habe eine geschriebene Verfassung und diese Verfassung sehe die Rechtsordnung dieses Staates als geschriebene vor [33]. Das ist ein Formargument, das eine Rückbesinnung auf die Funktionen vermissen läßt, die eine Bindung an die Gesetze erfüllen soll. Zwei Funktionen treten da zunächst ins Blickfeld. Einerseits stehen Kompetenzabgrenzungen innerhalb der Staatsgewalt und andererseits Machtbegrenzungen der Staatsgewalt gegenüber dem Bürger in Rede. Beide Hinsichten lassen die Rangordnungsfrage in unterschiedlichem Licht erscheinen. Bei den Kompetenzabgrenzungen innerhalb der Staatsgewalt ist es der einen Teilgewalt gestattet, der anderen Teilgewalt im Rahmen der verfassungsrechtlichen Funktionenordnung vorzuschreiben, wie zu entscheiden ist. Was sie vorschreibt, hängt vom Willen der mit entsprechender Macht ausgestatteten Teilgewalt ab. Darum spricht vieles dafür, den Willen zum entscheidenden Bindungskriterium zu erheben. Das von dieser Teilgewalt GESAGTE wäre damit nicht bedeutungslos. Es wäre ein Mittel (ein Mittel unter anderen, wenn auch ein außerordentlich wichtiges) zur Feststellung des maßgeblichen Willens. Richtpunkt und Ziel der Rechtsanwendungstätigkeit der anderen Teilgewalten aber wäre das von der rechtssetzenden Teilgewalt GEWOLLTE. Sich im GESAGTEN niederschlagende Redaktionsversehen und andere sprachliche Fehlleistungen wären bei der Rechtsanwendung ebenso zugunsten des GEWOLLTEN zu korrigieren wie “teleologische Fehlleistungen” [34].
Betrachtet man das Verhältnis der Staatsgewalt zum Bürger, so geht es auch hier zunächst um Willensbetätigungen der mit Regelungsbefugnissen ausgestatteten Staatsgewalt. Das spräche mit den gerade angestellten Erwägungen dafür, diesen Willen in der Rechtsanwendung zur Geltung zu bringen und dem GEWOLLTEN den Vorrang vor dem GESAGTEN einzuräumen. Doch ist es unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten zweifelhaft, ob der Wille der Staatsgewalt auch dann den Ausschlag geben darf, wenn es der Staatsgewalt nicht gelingt, diesen Willen für den rechtsunterworfenen Bürger erkennbar zum Ausdruck zu bringen. Hier kommt das auch aus der privatrechtlichen Rechtsgeschäftslehre bekannte Vertrauensargument zum Tragen, das den Wollenden an seine Erklärungsverantwortung erinnert und ihm Rechte gegenüber dem Willensunterworfenen nur gewährt, wenn die Rechte mit der Erklärung für den Erklärungsempfänger deutlich werden [35]. Eine Ausdehnung der Rechte über das Erklärte und damit über das (für den Erklärungsempfänger eindeutig) GESAGTE hinaus kommt nicht in Betracht. Für eine Einschränkung der Rechte stünde demgegenüber wieder das gesamte Argumentationsarsenal aus dem GEWOLLTEN zur Verfügung.
Nach dem bisherigen Erwägungen ergibt sich das folgende Zwischenergebnis: Ziel der Gesetzesbindung könnte es sein, den Willen des Gesetzgebers zu realisieren. Der Rechtsanwender hätte das vom Gesetzgeber GEWOLLTE auch dann zur Geltung zu bringen, wenn es im vom Gesetzgeber GESAGTEN keinen Niederschlag fände, mag dem eine sprachliche oder eine im engeren Sinne teleologische Fehlleistung des Gesetzgebers zugrundeliegen. Das GESAGTE wäre ein Mittel, dem GEWOLLTEN auf die Spur zu kommen. Selbstverständlich müßte dabei der Sprachgebrauch des Gesetzgebers den Ausschlag geben [36]. Und auch die Vernunft ließe sich hier noch unterbringen mit der nicht ganz ungefährlichen [37] Supposition, daß der Gesetzgeber mangels hinreichender Gegenanzeichen [38] das VERNÜNFTIGE gewollt habe. Die Zielbestimmung mit dem Vorrang des GEWOLLTEN fände ihre Grenze am Vertrauensschutz der normunterworfenen Bürger [39]. Soweit der Staat sie in Pflicht nehmen wollte, trüge er eine Erklärungsverantwortung, die die Pflichten auf das begrenzt, was mit dem GESAGTEN für den rechtsunterworfenen Bürger zum Ausdruck gebracht wird. Konsequenterweise müßten für die Feststellung des GESAGTEN insoweit die Verständnismöglichkeiten der rechtsunterworfenen Bürger zugrundegelegt werden.
Der Gesetzgeber könnte eine Regelung (und die zu ihr entwickelte Rechtsprechung) auch durch Schweigen zum Inhalt seines Willens machen. Das wäre nicht schon dann der Fall, wenn er schlicht nichts sagte, wohl aber dann, wenn er (etwa im Zuge von Teilreformen) die Änderung einer Regelung bedächte und ablehnte. Es ginge - allgemeiner - um das bewußte Unterlassen einer Änderung aus der bewußten Billigung einer bekannten Rechtsanwendungspraxis.
Was mich zögern läßt, den mit seinen allfälligen Konsequenzen beschriebenen Vorrang des GEWOLLTEN vor dem GESAGTEN zur verbindlichen Direktive der Rechtsanwendungslehre zu erheben, liegt in zweierlei begründet. Zum einen dürfte es praktisch außerordentlich schwierig sein sein, die Grenze zu ziehen zwischen den Rechtsvorschriften, die in einen wie immer gearteten (konkreten, abstrakten, typisierten?) Vertrauenstatbestand der rechtsunterworfenen Bürger einbezogen sind, und den Rechtsvorschriften, für die das nicht gilt. Zum anderen hat Bydlinski [40] ein Alternativmodell mit einem (vorläufigen) Vorrang des GESAGTEN vor dem GEWOLLTEN entwickelt, das praktikabel erscheint, weder einer Buchstabenjurisprudenz noch einer Gefühlsjurisprudenz Raum gibt, den Bedenken Rechnung trägt, die gegenüber dem Streben der objektiven Theorie nach “unbegrenzter Auslegung” erhoben werden, und schließlich frei von dem in der Begründungslehre aufscheinenden “Widerspruch” ist, einmal dem GEWOLLTEN und zum anderen dem GESAGTEN den Vorrang einzuräumen.
Bydlinski variiert die Frage nach dem Rangverhältnis. Er fragt nicht abstrakt nach dem Vorrang des GESAGTEN vor dem GEWOLLTEN, sondern will Kriterien dafür entwickeln, in welcher Reihenfolge die von ihm zuvor außerordentlich differenziert beschriebenen Methoden der Rechtsgewinnung [41] heranzuziehen sind und unter welchen Voraussetzungen zur jeweils nächsten Methode überzugehen ist bzw. wann von einem Übergang Abstand genommen werden kann. Dazu führt er ein Einfachheitskriterium ein, das der einfacheren Methode den Vorrang vor der schwierigeren Methode einräumt. Das Maß der Einfachheit wird an der Intensität der Bemühungen ausgerichtet, des Rechtsgewinnungsmaterials für die jeweilige Methode habhaft zu werden. Die folgende Reihung drängt sich danach geradezu auf: Sprachanalyse des Gesetzestextes als isoliertes Sprachgebilde, Analyse des Gesetzes als Bestandteil eines Satzsystems, Analyse des Gesetzes als Produkt realer menschlicher Vorstellungen und Wertungen und schließlich die Analyse des Gesetzes als Versuch einer Konkretisierung der Rechtsidee. Die Reihung kommt einem irgendwie bekannt vor, entspricht sie doch dem, wie man - konfrontiert mit einem neuen Fall - intuitiv an die Fallösung herangeht. Das besondere an Bydlinskis Vorschlag ist auch nicht die Reihung als solche, sondern die Entwicklung eines zusätzlichen Subsidiaritäts- und Abbruchkriteriums. Führt schon die einfachere Methode zum Ziel, treten die weniger einfachen Methoden als subsidiär zurück. Sie werden gar nicht mehr herangezogen [42].
Damit tritt klar zutage, daß die Entscheidung mit der Zielbestimmung und dem ihm korrespondierenden Abbruchkriterium fällt. Bydlinski scheidet den Abbau sprachlicher Unklarheit und das Rechtsgefühl als Kriterien mit den Zielen sprachliche Klarheit der gewonnenen Regel bzw. Übereinstimmung der Regel mit dem Rechtsgefühl aus. Dem kann man ohne weiteres beipflichten. Auch sprachlich klare Regeln werden ja mit Analogiebildungen und teleologischen Reduktionen korrigiert. Und das Rechtsgefühl verspricht keine intersubjektive Kontrollierbarkeit. Es bleibt alsdann das Ziel aller Rechtsgewinnungsvorgänge: die “Auffindung jener Lösung, die dem Recht (zumindest mit der relativ größten Wahrscheinlichkeit) entspricht” (S. 559). Recht aber ist für Bydlinski das positive Recht, soweit es nicht in krasser Weise gegen die Rechtsidee verstößt, und die Rechtsidee samt ihren Konkretisierungen in Rechtsprinzipien. Vorrang hat das positive Recht. Der möglicherweise unterschiedliche Gehalt des positiven Rechts je nachdem, ob die Norm als isoliertes Sprachgebilde, als Bestandteil eines Satzsystems, als Produkt realer menschlicher Vorstellungen und Wertungen oder als Versuch einer Konkretisierung der Rechtsidee verstanden wird, spielt für die Rangfrage als solche keine Rolle mehr. Hier steuert mit dem Einfachheitskriterium die Ökonomie, die den Übergang zur weniger einfachen Stufe der Feststellung des positiven Rechts nur zuläßt, wenn
Wann ein Ergebnis die zu 2) genannte Bedinung erfüllt, beschreibt Bydlinski so: “Es ist ohne sachlich verständliche Rechtfertigung unvereinbar mit den sonst in der Rechtsordnung anerkannten Wertungen, verletzt die offensichtlichen allgemeinen Erwartungen der Beteiligten und damit die Rechtssicherheit oder erweist sich, gemessen an den konkreten Zwecken bestimmter Rechtsinstitute oder Rechtsnormen als klar unzweckmäßig” (S. 561).
Offen ist noch, wie die Idee der Einfachheit gerechtfertigt werden kann. Auch sie steht für Bydlinski mit der Rechtsidee im Zusammenhang und erfährt von dieser ihre Legitimation. “Je einfacher das maßgebende (normative) Prämissenmaterial aufzufinden ist, umso verläßlicher und einheitlicher wird es auch in den jeweiligen Einzelfällen aufgefunden werden, so daß Gleichmäßigkeit und Voraussehbarkeit der Rechtsanwendung - in abstracto - so gut wie möglich gewahrt sind” (S. 557).
Gegenüber dieser Rangtheorie ist kaum etwas zu erinnern. Ergänzungsfähig und -würdig erscheint sie mir allenfalls um Informations- und Argumentationslastregeln, die auch präjudiziellen Festlegungen und allgemein akzeptierten Sätzen der wissenschaftlichen Rechtsdogmatik Eingang in die Diskussion verschaffen. Die zur Entscheidung eines konkreten Falles berufene Instanz darf unter den oben formulierten Voraussetzungen die Suche nach weiteren Informationen der nachrangigen Stufen der Rechtsgewinnung abbrechen. Sie muß sich jedoch mit solchen Informationen auseinandersetzen, die ein Verfahrensbeteiligter zum Widerspruch der ins Auge gefaßten Entscheidung mit den “objektiv-teleologischen Kriterien” aus den nachrangigen Stufen der Rechtsgewinnung aufbereitet, und hat bei widersprechenden präjudiziellen Festlegungen darzutun, daß die jetzt ins Auge gefaßte Regel deutlich besser begründet ist als die präjudiziell festgelegte Regel [43].
Prüfungsabfolge, Subsidiaritätskriterium und Argumentationslastregel legen eine Rangordnung für den fest, der nach einer Antwort auf die Frage sucht, was in einem Fall hic et nunc rechtens ist. Wie weit das Durchlaufen der Stationen zu gebundenem Entscheiden führt, bleibt jetzt zu erörtern. Gebundenes Entscheiden ist dadurch gekennzeichnet, daß der Entscheidungsträger nicht eigene Werthaltungen zum Maßstab der Entscheidung erhebt, sondern vorgegebene Normen und Bewertungen in der Entscheidung umsetzt. Die Möglichkeiten des gebundenen Entscheidens reichen mithin so weit, wie die auf den einzelnen Prüfungsstufen geforderten Informationen wie Tatsachen (also empirisch) festgestellt und mit der Antwort auf die gestellte Rechtsfrage in anerkannten Begründungsverfahren verbunden werden können. Die Möglichkeiten reichen weiter, als manche skeptische Beleuchtung der juristischen Methoden zu suggerieren sucht. Sie sind aber nicht unbegrenzt.
Stufe 1 fordert die Feststellung des mit der Gesetzesformulierung GESAGTEN. Das ist, nimmt man es genau, leichter gesagt als getan, aber nicht unmöglich. Unmöglichkeit suggeriert die moderne Hermeneutik [44]; übergroße Schwierigkeiten bisweilen die analytische Sprachphilosopie [45]. Entscheidend bleibt, was sich ohne theoretische Überspitzungen für das praktische Entscheiden ausmachen läßt. Was der Gesetzgeber gesagt hat, wird durch Wortgebrauchsregeln bestimmt [46]. Im Fachsprachgebrauch der Bedeutungstheoretiker spricht man auch von Sprachkonventionen. Das sind zum Teil explizit festgelegte, meist aber in einer bestimmten Sprechergruppe [47] implizit geltende Regeln. Wie kann man aber feststellen, daß in der maßgeblichen Sprechergruppe eine Sprachkonvention gilt, die dem gesetzlichen Ausdruck eine im konkreten Fall relevante Bedeutung verleiht? Es gibt dafür ein primitives und ein elaboriertes Verfahren: die Lehnstuhlmethode einerseits und eine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Erhebung der Regeln im Rahmen einer relevanten Sprechergruppe andererseits. Für praktisch tätige Juristen bleibt schon aus Kostengründen regelmäßig nichts anderes als die durch Selbstbefragung gekennzeichnete Lehnstuhlmethode. Darüber mögen Linguisten die Nase rümpfen. Bedenkt man indes, daß völlig unabhängig von der eingesetzten Methode das Ergebnis der Bedeutungsermittlung in den meisten der für den Juristen interessanten Fälle dasselbe ist, wäre es ganz unzweckmäßig, den Juristen um einer Sprachwahrheit willen, auf einen dornigen Weg zu schicken, der ihn der Lösung seines Entscheidungsproblems nicht näher bringt. Die primitive wie die elaborierte Methode werden nämlich in allen halbwegs interessanten Fällen Bedeutungsspielräume zutage fördern, Phänomene der Vagheit und Mehrdeutigkeit sowie des zeitlich und/oder personell inkonsistenten Sprachgebrauchs. Entscheidungsmöglichkeiten auf der Stufe der Sprachanalyse beschränken sich deshalb zunächst auf das Ausscheiden absolut sprachwidriger Auslegungshypothesen sowie auf die Anerkennung der Auslegungshypothesen, deren Verwerfung absolut sprachwidrig wäre. Diese Leistung vermag jeder Jurist als Angehöriger der Sprachgemeinschaft im Lehnstuhl durch Selbstbefragung zu erbringen. Jede Unsicherheit hebt ihn ohnehin auf die nächsten Stufen der Prüfung: Was ergibt sich aus dem Regelungszusammenhang, in den die fragliche Gesetzesregel gestellt ist? [48] Und was hat der Gesetzgeber gewollt? Wir wenden uns der Feststellung des GEWOLLTEN zu.
Ein Mittel zur Feststellung des vom Gesetzgeber GEWOLLTEN liegt in der sorgfältigen Erforschung der Entstehungsgeschichte. Eine wichtige Quelle zur Erforschung der Entstehungsgeschichte sind die Gesetzesmaterialien. Die in ihnen dokumentierten Vorstellungen der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Personen sind nicht etwa deshalb wertlos, weil die eigentlichen Entscheider, die zur Abstimmung berufenen Parlamentarier, ganz andere Vorstellungen gehabt haben könnten, die sie aber aus welchen Gründen auch immer für sich behalten hätten. Solange man dafür keine konkreten Anhaltspunkte findet, bleibt das Naheliegende: die das Gesetz tragende Mehrheit identifiziert sich mit den Zielen, die andere unwidersprochen öffentlich zur Begründung des Gesetzes vorgetragen haben. Aus bloßer Erkenntnisskepsis gespeiste Zweifel sind für das praktische Handeln des Juristen ebenso irrelevant wie Gewißheitsansprüche, die niemand zu erfüllen vermag.
Ein weiteres Mittel zum Erschließen des vom Gesetzgeber GEWOLLTEN bietet das vom Gesetzgeber eindeutig GESAGTE. Das klingt zunächst wie ein Münchhausentrick, entpuppt sich aber bei näherem Hinsehen als eine durchaus realistische Möglichkeit. Zwar bewegen wir uns auf der Stufe der Feststellung des GEWOLLTEN erst, wenn uns das GESAGTE keine verläßliche Auskunft über die in unserem Fall dem Recht entsprechende Lösung gibt. Deshalb kann das GESAGTE jetzt nicht schlicht die Lösung bereitstellen, selbst wenn es hülfe, das GEWOLLTE zu erschließen. Es geht vielmehr darum, in Ansehung der eindeutig von der gesetzlichen Regel erfaßten bzw. ausgeschlossenen Fälle, eine ratio legis zu erschließen, die alsdann einen Weg zur Lösung des nicht eindeutig erfaßten oder ausgeschlossenen, jetzt zu entscheidenden Falles weisen könnte. Hinter einem solchen Versuch verbergen sich zwei strukturell außerordentlich interessante Begründungsverfahren. Im ersten ist man bemüht, die ratio legis zu erschließen. Das erinnert an die Begründungsstruktur für eine wissenschaftliche Erklärung, mit der man den eindeutigen Gehalt der Regel unter Zuhilfenahme von Erfahrungssätzen über das Verhalten von Gesetzgebern und der sich darein fügenden ratio erklärt [49]. Im zweiten geht es um den Schluß von einer Zielsetzung, der ratio legis, auf eine Regel zur Verwirklichung der Zielsetzung.
Wir halten zunächst fest: Prinzipielle Einwände, die sich gegen Feststellungsmöglichkeiten des GEWOLLTEN überhaupt richten, greifen nicht. Wenn das GEWOLLTE festgestellt werden kann, ist damit noch nicht unbedingt gesagt, wie die Regel aussehen soll, die der Überbrückung der Kluft zwischen der Normformulierung und der Sachverhaltsbeschreibung zur deduktiv korrekten Begründung der Einzelfallentscheidung dient. Nur im einfachsten Fall beantwortet das GEWOLLTE die Auslegungsfrage unmittelbar. Dann decken sich das GEWOLLTE und die Entscheidungsfrage. Strukturfragen und Rekonstruktionsprobleme treten nicht auf. Schwieriger wird die Sache, wenn man GEWOLLTES zutage fördert, das sich nicht mit der Entscheidungsfrage, mit der zu begründenden Regel, deckt. Hier tritt die schon angedeutete Frage nach der Begründungsstruktur auf, unter der das GEWOLLTE eine Antwort auf die Entscheidungsfrage ermöglicht. Es geht um die Struktur teleologischer Argumente.
In der Juristischen Begründungslehre finden wir folgendes Strukturschema für teleologische Argumente [50].

Hier fallen verschiedene Dinge ins Auge.
1. Das Schema bringt zum Ausdruck, daß es um die Begründung bzw. Rechtfertigung eines normativen Satzes geht, der etwa lauten könnte: “Dieses Mittel soll eingesetzt werden.”
Das deckt sich mit unseren Erwartungen.
2. Es gibt offenbar keinen deduktiven Übergang von dem Gebotensein eines Ziels auf das Gebotensein eines Mittels. Was man braucht, ist eine zusätzliche Rationalitätsregel, die ihrerseits der Begründung harrt und sicherlich nicht lauten darf: “Der Zweck heiligt die Mittel!” Die in der Juristischen Begründungslehre angegebene Rationalitätsregel [51] macht das teleologische Argument deduktiv gültig. Sie hat eine lange philosophische Tradition [52] und kommt doch der hier perhorreszierten Regel bedenklich nahe.
3. Während wir erwarten, daß in einem Argument für den Einsatz eines Mittels etwas positiv zur Zielerreichung gesagt wird, ist in dem vorgestellten Strukturschema nur von solchen Mitteln die Rede, die notwendige Bedingungen der Zielerreichung sind und deshalb allenfalls negativ etwas zur Zielerreichung aussagen.
Für eine über die bisherigen Versuche in der Juristischen Begründungslehre hinausgehende Rekonstruktion der teleologischen Argumentation [53] wird man folgende Punkte in Rechnung stellen müssen:
Einen Weg zur Berücksichtigung der Punkte 2) und 3) könnten die Kausalanalysen von John L. Mackie weisen, mit denen sich Wolfgang Stegmüller in der 2. Auflage von Band 1 der Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, 1983, auseinandersetzt [54]. Für Mackie sind die Phänomene, die wir umgangssprachlich als Ursachen zu bezeichnen pflegen, sog. INUS-Bedingungen. INUS steht für insufficient, but necessary und unnecessary, but sufficient. Und eine INUS-Bedingung ist eine für sich allein nicht hinreichende, aber notwendige Bedingung in einem komplexen Bedingungsgefüge, das seinerseits hinreichend ist, aber nicht notwendig sein muß.
S ist danach eine INUS-Bedingung für Z, wenn gilt:
Wenn
falsch ist, d.h. noch ein weiteres hinreichendes Bedingungsgefüge ![]() in Betracht kommt, nämlich
in Betracht kommt, nämlich

und zugleich gilt
![]() ,
,
dann sind alle und nur die Konjunktionsglieder von ![]() je für sich INUS-Bedingungen von Z.
je für sich INUS-Bedingungen von Z.
Wenn wir teleologische Argumentationen auf der Bedingungsebene rekonstruieren [58], dann geht es um solche INUS-Bedingungen. Ein vorgeschlagenes Mittel muß nicht schlechthin notwendig sein. Es muß eine INUS-Bedingung sein. Es muß sich mithin als notwendiger Bestandteil eines komplexen Bedingungsgefüges auszeichnen lassen können, welches seinerseits für die Zielerreichung hinreichend ist.
Eine Schlußregel vom Gebotensein des Ziels auf das Gebotensein von INUS-Bedingungen für das Ziel gibt es nicht. Vorläufig kann man nur eine Negativregel aufstellen, wonach alle die Vorschläge ausgeschieden werden müssen, die nicht den Status einer INUS-Bedingung erreichen. Die umgekehrte positive Schlußregel scheitert aus zwei Gründen. Zum einen muß man damit rechnen, daß mehrere Vorschläge den INUS-Bedingungstest bestehen. Dann bedarf es einer zusätzlichen Wahlregel. Zum anderen mag es durchaus sein, daß auch in dem Fall, in dem nur ein einziger Vorschlag den INUS-Bedingungstest besteht, nicht auf das Gebotensein dieses einen Vorschlags geschlossen werden darf, weil etwa der Vorschlag als solcher normwidrig ist, und deshalb nicht realisiert werden darf. In einer deontisch perfekten Welt darf es aber nicht vorkommen, daß eine Handlung zugleich verboten und geboten ist.
Wir Juristen verfügen über einen prominenten Grundsatz, in dem die vorstehenden Überlegungen aufgehoben sind: den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz [59]. Er soll sicherstellen, daß Eingriffe in Grundrechte, die durch oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, geeignet, erforderlich und proportional sind. Die Eignung bestimmt sich nach der Eignung zur Zweckerreichung und kann nach der vorstehenden Analyse nur dann bejaht werden, wenn sich der Eingriff als INUS-Bedingung erweisen läßt. Die Erforderlichkeit entpuppt sich als Wahlregel zwischen verschiedenen Mitteln mit dem Status der INUS-Bedingung, weil alle die Eingriffe als nicht erforderlich gelten, bei denen andere geeignete Maßnahmen zu Gebote stehen, die mit einem weniger schwerwiegenden Eingriff in die Rechte des Bürgers verbunden sind. Die Proportionalität schließlich kann auch zur Verwerfung des einzig geeigneten Mittels führen, wenn die Grundrechtsbeeinträchtigung außer Verhältnis zum erstrebten Ziel steht. Dann bleibt nichts anderes, als das Ziel aufzugeben.
Aus allem dürfen wir folgende Neuformulierung einer Schlußregel für den Ziel-Mittel-Schluß in der juristischen Argumentationstheorie vorschlagen:
Ein Schluß vom Gebotensein eines Ziels auf das Gebotensein eines Mittels ist genau dann erlaubt, wenn
1. das Mittel die Merkmale einer INUS-Bedingung erfüllt;
2. bei mehreren die Bedingung 1) erfüllenden Mitteln, das Mittel die geringsten Kosten verursacht und
3. der Einsatz des Mittels nicht aus anderen Gründen verboten ist.
In einem neuen - deduktiv gültigen - Strukturschema gewinnt das Ganze folgende Gestalt [60]:
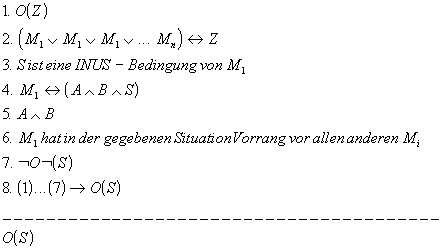
Damit haben wir nun eine ganz schön komplexe Struktur einer Regelfestlegung zur Verwirklichung des vom Gesetzgeber GEWOLLTEN herausgearbeitet und zugleich gezeigt, daß der Rechtsanwender mit einer solchen Festlegung nicht notwendig den Rahmen empirischer Analysen sprengt, sondern im Gegenteil die Möglichkeiten der Gesetzesbindung wahrt. Abschließend wollen wir noch die Frage nach eventuellen Bindungsmöglichkeiten jenseits des vom Gesetzgeber GESAGTEN und GEWOLLTEN streifen.
Solche Bindungsmöglichkeiten bestehen sicherlich dort, wo andere als dem Gesetzgeber zuschreibbare Ziele und Zwecke in das gerade entwickelte Strukturschema eingestellt werden können. Die Frage muß dann lauten, ob man auch diese anderen Zwecke noch mit empirischen Verfahren gewinnen kann?
Man mag an die grundlegenden Prinzipien unserer Verfassung denken. Doch stehen wir hier bald vor dem Problem, daß diese Prinzipien keineswegs immer miteinander harmonieren. Für Kollisionsfälle müssen Vorrangregeln gebildet werden [61]. Wir streben nach praktischer Konkordanz. Den Vorgang nennen wir Güter- und Interessenabwägung. Selbstgerechte Kritiker heißen ihn auch auch Wertegeschaukel. Für unsere Fragestellung ist entscheidend, daß es mindestens für die erstmalige Bildung der Vorrangregeln kaum noch empirisch feststellbare Vorgaben gibt. Spätestens hier beginnt für den Rechtsanwender das normative Geschäft, das sich nicht mehr mit empirischen Mitteln allein bewältigen läßt, weil
In der Juristischen Begründungslehre [62] schlagen wir eine Definition vor, wonach alle und nur diejenigen Normen gerecht heißen sollen, denen die Normbetroffenen mit Rücksicht auf ihr wohlverstandenes Eigeninteresse zustimmen können. Die Einlösung dieser Definition stößt auf theoretische und praktische Schwierigkeiten. Philosophen mag sie zu Forderungen nach herrschaftsfreien Diskursen veranlassen. Für den, der entscheiden muß, fordern wir die Fähigkeit und Bereitschaft zur Unparteilichkeit, zum hypothetischen Rollentausch, zur Verarbeitung empirischen Wissens über Wünsche und Interessen der Normbetroffenen und über die Zusammenhänge zwischen diesen und der ins Auge gefaßten Norm und schließlich zur Bewertung der Wünsche und Interessen. Im letzten Schritt liegt in der Tat das unhintergehbare: “Ich will es so!”, auf das Christoph von Mettenheim [63] so stark abhebt.
An der Berechtigung der Definition und der mit ihr verbundenen Forderungen führen auch die Vorschläge Norbert Hoersters für eine “Rechtsethik ohne Metaphysik” [64] nicht vorbei. Danach kann eine Norm immer nur für das Individuum begründet sein, dessen Interessen die Norm fördert. Ein Individuum, das seine Interessen anders definiert als der Normgeber, kann durch nichts anderes als Macht zur Normbefolgung angehalten werden. Dieser Ansatz wird von Hoerster mit frappierender Konsequenz durchdacht und analysiert [65]. Und dennoch verbergen sich dahinter nicht weitere Verfahren der Rechtsbegründung ohne Wertung, die für den Entscheider von Einzelfragen nutzbar gemacht werden könnten. Denn der steht vor der Frage legitimer Machtausübung. Wer nach der Begründung einer richterlichen Entscheidung fragt, fragt nicht, ob die Entscheidung im Hinblick auf die Interessen des Richters begründet ist. Er fragt auch nicht die im konkreten Verfahren Entscheidungsbetroffenen, welche Entscheidung sie im Hinblick auf ihre Interessen für begründet halten. Er fragt nach der Begründung der Entscheidung für alle - in Sonderheit die Normbetroffenen. Deren Interessen muß der Richter in Erwägung ziehen. Und so bleibt es dabei, daß jenseits der Gesetzesbindung vor der Machtausübung, vor der Willensbetätigung, der Versuch des Entscheiders stehen muß, die Norm, aus der die Entscheidung schließlich folgt, als gerecht auszuweisen, d.h. zu zeigen, daß ihr alle Betroffenen in ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse zustimmen können. Das (erst) sprengt den Rahmen empirischer Verfahren und überschreitet die Möglichkeiten gebundenen Entscheidens.
Ich fasse zusammen:
Ein Jurist, der mit der Bindung an das vom Gesetzgeber Gesagte und Gewollte (Zwecke) bei der Rechtsanwendungstätigkeit ernst macht, kann einen weiten Bereich seiner Begründungsaufgaben mit zwar bisweilen außerordentlich komplexen, aber doch solchen Verfahren erledigen, die ihn der Eigenwertung entheben. Er stößt erst dann an die Grenzen solcher Tätigkeit, wenn er für seine Einzelfallentscheidung Prinzipien- und Zielkonflikte im Wege sog. Güterabwägung bewältigen muß.